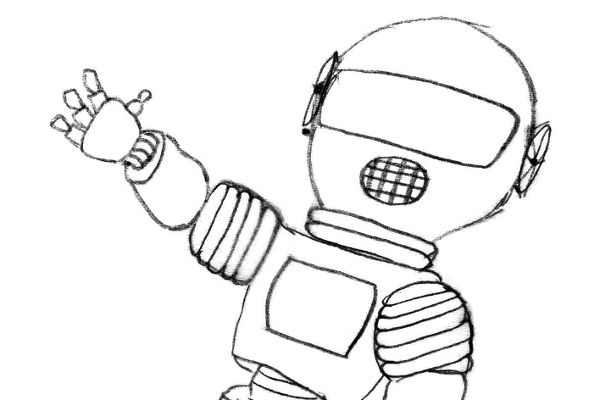Wo soll das Geld für den Sozialstaat herkommen, damit er auch in Zukunft seine Leistungen erbringen kann? Maschinen und Roboter erhalten keine Löhne.
Es stellt sich daher zunehmend die Frage, von wem der Staat in Zukunft die nötigen Beiträge für die Gesundheitsversorgung, Pensionen, Arbeitslosengeld und andere Sozialleistungen (Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Schülerfreifahrt etc.) einheben soll?
Eine alternative Finanzierungsform ist zum Beispiel die Wertschöpfungsabgabe.
Ein lange nicht mehr gesprochenes Wort geistert durch Österreich. Es klingt ein wenig altmodisch, und keiner versteht es so richtig. Aber das Wort ist einprägsam und taucht immer wieder in Zeitungen und Fernsehen auf: die Maschinensteuer oder Wertschöpfungsabgabe
Worum geht es genau? Was soll das sein?
Wer das wissen will, stößt auf ein Konzept mit Geschichte. Aufgekommen in den Gewerkschaftskreisen mehrerer europäischer Länder in den 1970er- und 1980er-Jahren, interessierte sich lange niemand dafür. Doch seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 nimmt die Debatte an Fahrt auf. Das Konzept ist durchaus kompliziert, zudem gibt es mehrere Versionen. Doch die Grundfrage dahinter ist einfach: Wo soll das Geld für den Sozialstaat herkommen, damit er auch in Zukunft seine Leistungen erbringen kann?
Wenn die Sozialversicherung weiterhin ausschließlich von Löhnen und Gehältern abhängt, steht ihr langfristig immer weniger Geld zur Verfügung – und schließlich muss sie ihre Leistungen reduzieren.
Das hängt vor allem mit dem technischen Fortschritt zusammen. In den hochautomatisierten und -vernetzten Betrieben von heute braucht es keine abertausende FließbandarbeiterInnen mehr. Es reichen ein paar ManagerInnen und gutbezahlte Fachkräfte, die Roboter programmieren. Sie profitieren vom maschinengetriebenen Reichtum, während die Löhne der breiten Masse seit Langem stagnieren oder zurückgehen. Nichts deutet darauf hin, dass sich diese Entwicklung umkehrt.
Im Gegenteil: Laut der OECD könnten zwölf Prozent der Arbeitsplätze in Österreich durch maschinelle Tätigkeiten ersetzt werden.
Das betrifft nicht nur Österreich. In Italien wurde eine geringe Wertschöpfungsabgabe bereits im Jahr 1999 unter Ministerpräsident Mario Monti eingeführt. In Deutschland wird gerade darüber diskutiert. Die Abgabe „könnte eine Möglichkeit sein, um das finanzwirtschaftliche Gleichgewicht der Sozialversicherungen zu gewährleisten“, schreibt etwa der Ökonom und Pensionsexperte Bert Rürup.
Um das besser zu verstehen, muss man begreifen, wie sich Sozialversicherungen derzeit finanzieren:
im Wesentlichen über Beiträge der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen. In Österreich etwa sorgt der Staat dafür, dass alle BürgerInnen kranken-, unfall- und pensionsversichert sind.
Dafür liefert jede/r Beschäftigte derzeit 14 Prozent seines/ ihres Brutto-Monatsgehalts (bis zu einer Obergrenze von 4.860 Euro) an die staatliche Sozialversicherung ab.
Die ArbeitgeberInnen legen noch etwas drauf, 18 Prozent des Lohns, die einen großen Teil der sogenannten Lohnnebenkosten bilden.
Die Wertschöpfungsabgabe zielt auf eine Reform der ArbeitgeberInnenbeiträge zur Sozialversicherung ab.
Der Personalaufwand ist keine taugliche Messgröße für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Hocherfolgreiche Konzerne, etwa im Bereich der Neuen Technologien, und ihre EigentümerInnen fahren unter Umständen mit fast keinen MitarbeiterInnen Milliardengewinne ein. Trotzdem tragen sie, im Vergleich mit personalstarken Betrieben (zum Beispiel einem klassischen Kaufhaus oder Restaurant), nur wenig Sozialabgaben bei.
Während die Lohnabgaben – einzige Einnahmequelle der Sozialversicherung – weniger sprudeln, braucht die Sozialversicherung zugleich mehr Geld. Denn die Alterung der Bevölkerung führt zu höherem Pflegebedarf. Herausfordernde Zeiten also für den Sozialstaat. Will er seine Leistungen nicht zurückfahren, darf seine Finanzierung langfristig nicht mehr nur an den Löhnen hängen. Aber woran sonst? Hier kommt die Wertschöpfungsabgabe ins Spiel.
Es geht darum, dass die Sozialversicherungsbeiträge der ArbeitgeberInnen auf neue Weise berechnet werden (jene der ArbeitnehmerInnen blieben unverändert). Sie sollen sich nicht mehr nur an den Löhnen orientieren, sondern etwa auch am Gewinn des jeweiligen Unternehmens. Und an verschiedenen Aufwendungen, die es hat.
- Etwa an Zinsen, die der Betrieb auf geborgtes Geld zahlt.
- Oder an den Abschreibungen auf Betriebsanlagen, die über mehrere Jahre verteilt in der Bilanz verbucht werden (also den Kosten für Investitionen).
- Eben an all dem, womit ein Unternehmen einen Wert erwirtschaftet – daher auch der Ausdruck „Wertschöpfungsabgabe“.
Gewinn, Abschreibungen und Zinsen werden künftig zur Summe der Löhne addiert. Und von allem zusammen geht ein Prozentsatz an die Sozialversicherung.
Die Wertschöpfungsabgabe würde das Ungleichgewicht zwischen personal- und kapitalintensiven Unternehmen ausgleichen und die langfristige Finanzierbarkeit der Sozialversicherung sicherstellen und auch für neue Jobs sorgen, weil die Lohnnebenkosten sinken. Die Arbeit wäre billiger, mit weniger Abgaben belastet.
Alles gut also? Ein unumstrittenes Projekt mit offenkundigem Nutzen? Nein, bei Weitem nicht.
Denn es bleibt eine große Sorge bei der Wertschöpfungsabgabe:
Relativ gesehen unterliegt ja alles außer der Arbeit höheren Abgaben, wird also teurer. Deshalb, so die Sorge, könnten Unternehmer künftig lieber Arbeiter einstellen, als Maschinen anzuwerfen.
Die andere Seite der Medaille
Das Umsetzen der Maschinensteuer/Wertschöpfungsabgabe beinhaltet aber auch Kritikpunkte und Angstszenarien:
- Auf Dauer wird die Wirtschaft geschwächt
- Österreich verliert an Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Staaten.
- Unternehmen wandern ab, technisches Wissen geht verloren.
- Verluste an Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, weil man „Investitionen und Gewinne benachteiligt“.
- Bremsen des technischen Fortschritts und ungünstige Auswirkungen auf Produktivität und Investitionstätigkeit.
Wie die Wertschöpfungsabgabe in Österreich konkret aussehen könnte, ist noch offen. Aber die Idee der Wertschöpfungsabgabe ist im öffentlichen Bewusstsein angelangt.
Und damit auch die verfestigte Überzeugung, dass der Sozialstaat nicht zum Großteil über Personalkosten dauerhaft finanziert werden kann.